Zwölf Start-ups für Inkubationsprogramm von Intel, Cisco und Telekom zum Internet der Dinge ausgewählt
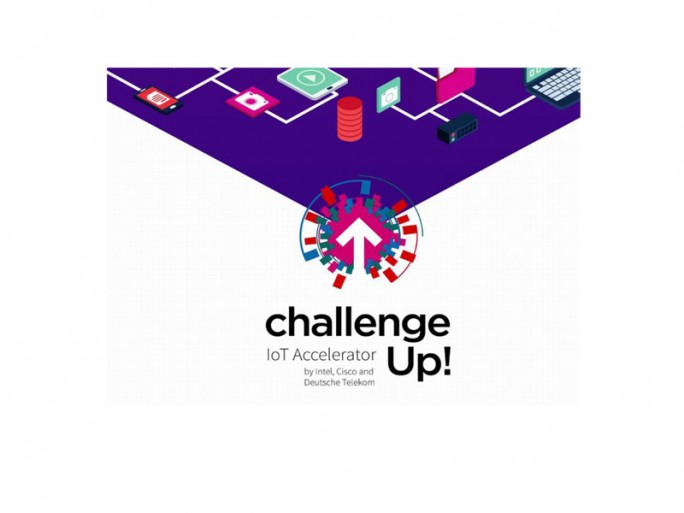
Sie haben sich im Rahmen eines europaweiten Wettbewerbs unter 300 Bewerbern durchgesetzt. Mit der Challenge Up! Acceleration Week vergangene Woche in Krakau erhielten die Firmengründer Tipps für den weiteren Aufbau ihrer Unternehmen. Aus Deutschland sind die Firmen ProGlove und Senic dabei.
Cisco, Deutsche Telekom und Intel haben sich nach einem europaweiten Wettbewerb mit 300 Teilnehmer für zwölf Start-ups entscheiden, die in das gemeinsame Inkubatorprogramm Challenge Up der drei Firmen aufgenommen werden. Dieses ist bis November dieses Jahres angelegt. Nach der Auftaktveranstaltung vergangen Woche in Krakau folgen weitere in Berlin und London. Start-ups, die das Programm erfolgreich absolvieren, haben die Aussicht auf Investitionen durch die organisierenden Firmen oder Wagniskapitalgeber. Die Entscheidungen sollen auf dem Challenge Up Summit im Rahmen der Technologiekonferenz unBoundDigital vom 30. November bis 1. Dezember in London bekannt gegeben werden.
Mit Challenge Up wollen Cisco, Deutsche Telekom und Intel Start-ups im Bereich Internet der Dinge zu einem schnelleren Markteintritt verhelfen. Dazu gewähren sie ihnen Zugang zu eigenen Ressourcen, führen gemeinsame Projekte durch für die Mentoren abgestellt sind und bieten ihnen Zugang zu ihren Kontakten in der Branche.
Zwei der nun dafür ausgewählten zwölf Firmen stammen aus Deutschland. ProGlove ist ein intelligenter Handschuh, der dazu beitragen soll, Arbeitsprozesse zu verbessern. Dazu kann er zum Beispiel als Scanner oder zum Empfang von Meldungen verwendet werden. Senic hat ein universelles Gerät zur Steuerung von intelligenten Leuchtmitteln, Schlössern, Thermostaten oder Lautsprechern mittels einfacher Gesten entwickelt. Apps auf dem Smartphone sollen sich dadurch erübrigen.
Schwerpunkte der übrigen Firmen liegen darauf, neue Möglichkeiten für den Einzelhandel zu schaffen, Automatisierung und Steuerung in der Industrie zu verbessern sowie den Bereichen Smart Home und Smart City. Eine Ausnahme ist die Firma Admetsys aus Dänemark, die mit ihrem Produkt ohne Blutverlust und unmittelbar Blutzuckerwerte von Diabetikern im Krankenhaus misst und so steuert, dass ihr Blutzuckerspiegel dem eines gesunden Patienten entspricht.

Den Bereich Smart Home bedient ComfyLight aus der Schweiz. Der vernetzte LED-Leuchtkörper mit Präsenzsensor speichert Bewegungsabläufe der Hausbewohner und kann diese dann in deren Abwesenheit nachahmen. Das Haus erscheint so bewohnt, was Einbrecher abschrecken soll. OORT aus Polen baut mit seiner gleichnamigen, zum Patent angemeldeten Technologie ein offenes Ökosystems aus intelligenten Geräten, Sensoren, Mobilfunk-Software und einer Cloud-Plattform auf. Das darauf basierende Smart Home-System auf Basis von Bluetooth Smart lässt sich über jedes internetfähige Gerät steuern. Devicehub.net aus Rumänien bietet ebenfalls eine Plattform, die jedes mit Strom betriebene Gerät erfassen und dieses dann über das Internet steuern und überwachen kann.
Eher der smarten Fabrik als dem smarten Zuhause widmen sich die Start-ups n-Join aus Israel und Waylay aus Belgien. Dazu will n-join mit neuen Entwicklungen im Bereich im Internet der Dinge Produktionsanlagen flexibler auslegen, Waylay bietet eine Automatisierungsplattform, die Internet der Dinge und IT-Systeme und Online-Dienste von Unternehmen zusammenführt.

Technologie zur Optimierung im Einzelhandle bieten das litauische Start-up Semsey und Taggalo aus Italien. Während die Litauer auf eine kleine Kamera und eigene Algorithmen für die Bildbearbeitung setzen, um Personen zu zählen und damit die Grundlage für Effizienzsteigerung im Einzelhandel zu schaffen, baut Taggalo eine offene Plattform, die sowohl Bildanalyse, WLAN-Verfolgung als auch Beacon-Technologien in einem Sensor zusammenführt und so die unmittelbare Erfassung von Kundenfrequenz, Verweildauer, Rückkehrfrequenz und demographische Daten der Kundschaft ermöglicht.
Im Bereich Smart City sind das israelische Start-up HiPark und das bereits international beachtete, polnische Start-up Ifinity angesiedelt. Während sich Hi-Park darauf konzentriert, mittels Smartphone-Kameras Daten über freie Parkplätze zu sammeln und die Parkplatzsuchenden zur Verfügung zu stellen, ist die Einweisung in den nächstgelegenen freien Parkplatz nur ein Aspekt von Ifinity. Das polnische Unternehmen ermöglicht mit seinem beacon-basierende Ansatz Städten etwa Zusatzinformationen für Sehbehinderte zu vermitteln, Universitäten Wegweisersysteme einzurichten oder Kunden im Einzelhandel zu dem Regal zu führen, in dem die gesuchte Ware liegt.
