Online-Wahlhilfen für Unentschlossene im Überblick

Laut dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend des Wahlforschungsinstituts Infratest dimap wissen 33 Prozent der deutschen Jungwähler im Alter zwischen 18 und 29 Jahren noch nicht, für welche Partei sie bei der Bundestagswahl ihr Kreuzchen setzen wollen. Eine große Gruppe also, die sich besonders gut mit einem Aspekt des Wahlkampfes 2013 auskennt, der diesen entscheidend mitprägt – dem Internet.
Die jungen Unschlüssigen – aber auch alle anderen – können jenes digitale Instrument nämlich zur Entscheidungsfindung nutzen. Dies funktioniert über so genannte Online-Wahlentscheidungshilfen. ITespresso gibt einen Überblick über die ausgewählte Angebote und erklärt, was jedes Einzelne leistet.
Bei der Mehrzahl der vorgestellten Tools werden die eigenen Standpunkte zu unterschiedlichen Themengebieten mit den Wahlprogrammen ausgewählter Parteien verglichen. Am Ende erfolgt eine Auswertung, welcher Partei beziehungsweise welchen Parteien man inhaltlich am nächsten steht. Eine Ausnahme bildet das interaktive Google-Angebot: Dieses kann man nutzen, um selbständig zu einer Entscheidung zu gelangen.

Thematisch decken die nachfolgenden Wahlentscheidungshilfen größtenteils das komplette Spektrum ab, das in den vergangenen Wochen und Monaten vor der Wahl in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Eines der Angebote fokussiert sich allerdings auf die Frage, mit welcher Partei man in Bezug auf die Höhe der eigenen Einkommensteuer am besten fährt. Wer hingegen seine netzpolitischen Ansichten, etwa zum Thema “Datenschutz”, mit den Wahlprogrammen der relevanten Parteien vergleichen will, der bekommt in einem früheren Artikel bei ITespresso einen kompakten Überblick.
Wahl-O-Mat
Das derzeit bekannteste und populärste Tool unter den Online-Wahlentscheidungshilfen konzentriert sich ganz auf die unentschiedenen Jungwähler. Der Wahl-O-Mat ist sozusagen ein Produkt der eigenen Zielgruppe. Laut Impressum besteht dessen Redaktionsteam nämlich aus 25 jungen Wählern im Alter zwischen 18 und 26 Jahren. Diese zeichnen für mehr als 30 Thesen verantwortlich, die der Unentschlossene durchläuft, um sich den Entscheidungsprozess zu erleichtern.
Der Großteil der zur Wahl zugelassenen Parteien hat sich eigens für das Wahl-O-Mat-Team positioniert und dessen Fragebögen beantwortet. Inhaltlich decken die Wahl-O-Mat-Thesen die komplette Bandbreite aktueller Politthemen ab. Die allererste befasst sich beispielsweise mit dem viel diskutierten Mindestlohn und lautet dementsprechend: “Es soll ein gesetzlicher flächendeckender Mindestlohn eingeführt werden”. Dieser These kann der Entscheidungssuchende entweder zustimmen oder sie ablehnen. Alternativ besteht die Möglichkeit, eine neutrale Antwort zu geben oder die These einfach zu überspringen und zur nächsten überzugehen.
Hat der Wähler alle angebotenen Thesen durchlaufen, kann er beliebig viele davon doppelt gewichten und dadurch ein präziseres Ergebnis erhalten. Im Anschluss kann er bis zu acht Parteien selektieren, mit denen er seinen Standpunkt abgeglichen haben möchte. Ein Algorithmus vergleicht automatisiert die Positionen des Wählers mit jenen der ausgewählten Parteien und zeigt in Form von Balkendiagrammen in abnehmender Reihenfolge, welchem politischen Lager er inhaltlich am nächsten steht. Anschließend kann der Wähler noch begründete Parteiaussagen zu jeder einzelnen These einsehen und hat die Möglichkeit, eine PDF-Datei mit einem parteienvergleichenden Überblick aller Antworten herunterzuladen.
Bundeswahlkompass
Das Online-Tool Bundeswahlkompass ist ein wissenschaftliches Projekt von Forschern der Universität Bamberg und der Freien Universität Amsterdam. Es kann als Konkurrenzprodukt zum etablierten Wahl-O-Mat gesehen werden, denn es ist ähnlich aufgebaut und bietet bekannte Funktionen: Auch hier werden dem Nutzer 30 Thesen aus dem breiten parteipolitischen Themenspektrum präsentiert, die dieser bejahen, verneinen oder überspringen kann. Auch eine neutrale Positionierung gegenüber einer bestimmten These ist möglich.

Am Ende der Stellungnahme steht dann wieder ein Algorithmus, der seine Positionen automatisiert mit den Standpunkten der Parteien abgleicht und eine entsprechende Auswertung vornimmt. Ein paar kleinere Unterschiede gibt es beim Bundeswahlkompass dann aber doch: So wird der Wähler vor Beginn seiner Stellungnahme mit persönlichen Fragen zu Alter, Geschlecht oder Bildungsabschluss konfrontiert. Darüber hinaus sind die Antwortmöglichkeiten zu den einzelnen Thesen genauer abgestuft. So kann man dort beispielsweise nicht nur “zustimmen”, sondern sogar “vollkommen zustimmen”.
Nach dem automatischen Abgleich von Wähler- und Parteiposition zeigt das Tool dem Nutzer ein Koordinatensystem, das die politische Richtung des Wählers als roten Punkt in der Nähe entsprechender Parteien verortet. Diese Nähe wird durch eine ellipsenförmige Markierung verdeutlicht. Im Gegensatz zu einem echten Kompass zeigt der Bundeswahlkompass jedoch keine Himmelsrichtungen an, sondern lokalisiert die Parteien und schließlich auch den Wähler als wirtschaftlich links oder rechts beziehungsweise als sozial progressiv oder konservativ. Wer auf das Logo einer Partei im Koordinatensystem klickt, erhält zudem einen Vergleich zwischen seiner eigenen Antwort und der der jeweiligen Partei.
VideoWahlCheck
Einen etwas anderen Ansatz zur Wahlentscheidungshilfe verfolgt die Firma Webvideo.com, die sich auf Video-Marketing im Internet spezialisiert hat. Auf YouTube führt Unternehmensgründer Andreas Graap durch den VideoWahlCheck 2013. Dabei handelt es sich um ein interaktives Informationsangebot, das den unentschlossenen Wähler – wie eine Art “Video-Wahl-O-Mat” – durch sieben ausgewählte Fragen aus der deutschen Politiklandschaft führt.
In mehreren aufeinanderfolgenden YouTube-Videos kann der Nutzer unter anderem Fragen zur Vorratsdatenspeicherung oder zum Tempolimit auf deutschen Autobahnen beantworten. Durch Klick auf einen interaktiven Button, der am Ende einer Frage eingeblendet wird, kann der Zuschauer entscheiden, ob er beim “Mindestlohn” “dafür” oder “dagegen” ist und wird anschließend automatisch zum nächsten Video weitergeleitet. Als Testergebnis wird ihm im letzten Video dann angezeigt, mit welchen Parteien er die höchste Übereinstimmung erzielt.
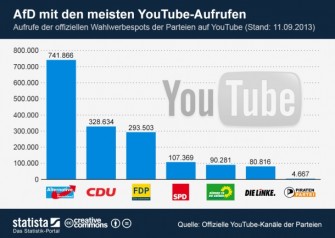
Steuer-O-Mat
Der Steuer-O-Mat ist vor allem für jene interessant, die sich für die Zeit nach der Bundestagswahl in erster Linie um ihren Geldbeutel Sorgen machen. Mit dem Steuer-O-Mat lässt sich nämlich automatisiert errechnen, mit welcher Partei man im Hinblick auf die Einkommensteuer künftig mehr Netto vom Brutto hat und mit welcher weniger. Für diese Kalkulation auf Basis der entsprechenden Partei-Wahlprogramme benötigt der zugehörige Algorithmus lediglich drei ausgewählte Fragen zu Familienstand, zur Anzahl der Kinder sowie dem Jahresbruttoeinkommen.
Als Ergebnis bekommt der Wähler nicht nur angezeigt, bei welcher Bundestagspartei er in Sachen Steuerbelastung zu den künftigen Gewinnern oder Verlieren zählt, sondern auch welchen Steuerbetrag er im Jahr 2013 zu zahlen hat. Hinter dem Tool steht die Firma Smartsteuer GmbH, die sich eigentlich auf Online-Steuererklärungsangebote spezialisiert hat.
Google Politik & Wahlen
Auch Google möchte nach dem Vorbild der letzten US-Wahlen seinen Teil zur Entscheidungshilfe beitragen und hat ein entsprechendes Online-Portal gestartet. In diesem Fall steht kein Automat beziehungsweise Algorithmus, der den Entscheidungsprozess für den unentschiedenen Wähler übernehmen könnte, dahinter: Das interaktive Google-Informationsportal Politik & Wahlen lädt vielmehr zur eigenen Meinungsbildung ein.
Über bestimmte Keywords lässt sich zum Beispiel nach aktuellen politischen Trendthemen suchen und via Google Plus munter drauf los diskutieren. Außerdem gibt es auf Neu- und Nichtwähler zugeschnittene Google Video Hangouts, bei denen Politiker-Interviews aus der Sicht eines Politik-Dummies geführt werden. Hierbei soll ein Politiker das jeweilige Thema so verständlich wie möglich erklären. Darüber hinaus gibt es noch Experten-Hangouts, in welchen allgemeinpolitische Themen diskutiert werden. Beispielsweise wird der Frage nachgegangen, ob Angela Merkel eine dritte Amtszeit verdient habe. Für die Portal-Inhalte ist nicht etwa Google selbst, sondern die Informations- und Kommunikationsplattform politik-digital.de zuständig, ein Anbieter von Politker-Chats.
Wer eines dieser Online-Tools genutzt hat und auf diesem Wege tatsächlich zu einer Entscheidung zugunsten einer bestimmten Partei gekommen sein sollte, kann noch einen Schritt weitergehen: Über die so genannte Koalitionenbörse kann der Wähler dann noch darüber spekulieren, welche Regierungskoalition seine Partei mit anderen Parteien künftig vielleicht bilden wird. Für das Wahlspiel muss sich der Politik-Spekulant vorher kostenlos registrieren. Anschließend lassen sich Koalitionsaktien kaufen oder verkaufen.
Was wissen Sie über Netzpolitik? Machen Sie den Test mit 15 Fragen auf silicon.de.